Der Wald-Wild-Konflikt
Der Wald-Wild-Konflikt hat seine Ursache im forstwirtschaftlichen und ökologischen Schaden, den Schalenwild als Pflanzenfresser Bäumen und anderen Pflanzen des Waldes zufügt. Durch Verbeißen, Schälen oder Fegen können Schäden entstehen, die den Holzwert mindern oder eine Waldpflanzengesellschaft verarmen lassen. Die Diskussion um zu hohe Schalenwildbestände wie Rehe, Rothirsche oder Damhirsche wird insbesondere von Waldbesitzern geführt. Ziel ihrer Angriffe sind die Jäger, welche das Jagen als Freizeitbeschäftigung in und mit der Natur verstehen und eher ein Mehr an Wild im Wald wünschen. Die Diskussion führt man vorrangig in den eigenen Interessenskreisen und kreist dabei lieber in sich selbst als das Gespräch mit den anderen zu suchen.

Übersehen wird dabei, dass das Wild als Pflanzenfresser Verbeißen, Fegen und z.T. Schälen als natürliche Lebensäußerungen zeigt und es also ein natürliches Maß an Schaden gibt. Überlagert wird die Diskussion durch das historische Erbe dominanter Jagdausübung in der Feudalzeit und eine eher nachteilige Auswirkung der Abschussplanungen durch die Jagdgesetze der 20iger und 30iger Jahre. Welche biologische Einsicht fehlt nun aber den Menschen in diesem Konflikt:
Die Langfristigkeit der Wirkmechanismen im Wald bildet Ungleichgewichte von Wald und Wild noch nach 200 Jahren ab. Jäger werden zudem nie die Wirksamkeit des evolutionsbestimmten Raubwildes erreichen, das sich mit der eigenen Populationsentwicklung dem Schalenwild als Ernährungsangebot anpasst und gleichzeitig durch Selektion den Fortbestand von Reh und Hirsch sichert. Dieser Teil des struggle for existence hat letztlich mit zur Ausgestaltung der natürlichen ( geringer Einfluss des Menschen ) Waldgesellschaften geführt. Die Vorstellung, Jäger könnten die nicht mehr vorkommenden großen Raubwildarten wie Bär, Luchs oder Wolf ersetzen, wird sich also nur zum Teil erfüllen lassen. Letzterer Gedanke wird dann zur Farce, wenn die Jagd nur der Erlegung von Trophäen gewidmet ist.
Die menschliche Kultur hat die Lebensräume des Wildes durch Besiedlung, trennende Verkehrswege und Ausgestaltung einer nutzbaren Natur so wesentlich verändert und verkleinert, dass die Nahrungsaufnahme der Waldtiere gestört ist. Der Waldbesitzer wird den Wald für sich nicht nur als Einnahmequelle sehen dürfen, er hat einen Teil dieser Einnahmen für den Lebensraumerhalt der Waldtiere einzusetzen. Dazu gehören dann auch einzelne Schutzmaßnahmen, der Verzicht auf höchsten Ertrag an jeder Stelle und die gezielte Ausbringung von Äsungspflanzen. Die Jäger haben dabei auch ihren Anteil zu erbringen. Diese Auffassung hat sich bisher nur teilweise durchsetzen können, geht der wirtschaftende Mensch doch zunächst immer noch davon aus, dass die ihm „untergeordnete Natur“ seinen Ansprüchen dienen muss.
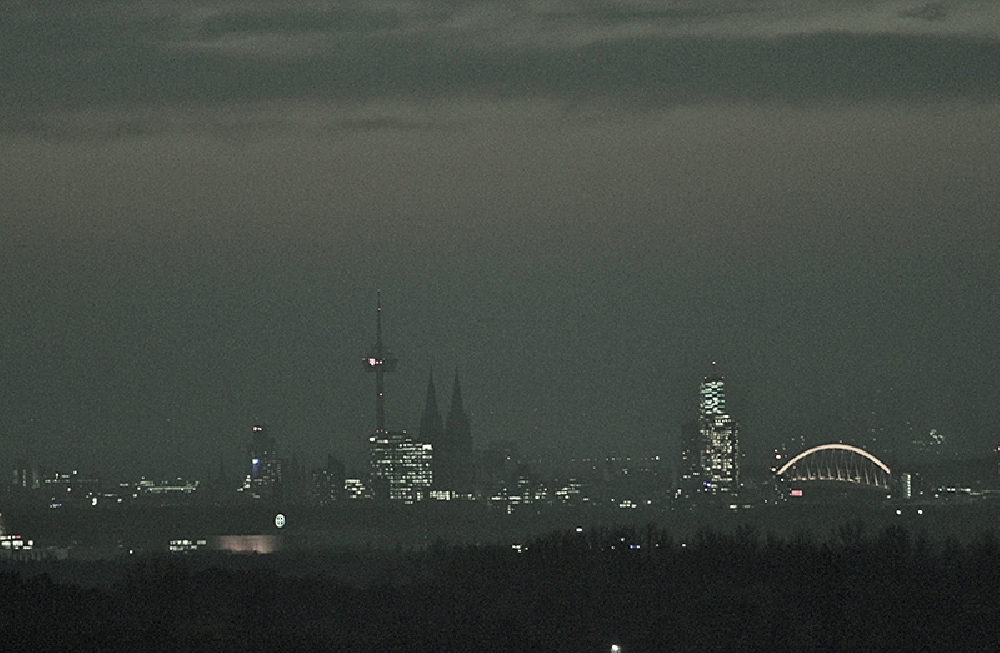
Schließlich wird der Konflikt zwischen Waldbesitzern und Jägern aber auch von vielen anderen Aktivitäten des Menschen im Wald überlagert. Dazu gehören Sport, Tourismus und Erholungssuchende. Wie sehr diese Störungen auf die Nahrungsaufnahme des Schalenwildes einwirken, ist nur zum Teil zu erfassen. Der Großteil des Schalenwildes ist als Wiederkäuer auf geregelte Phasen der Aufnahme von Nahrung und ihrer Aufbereitung im Körper angewiesen. Deshalb muss auch hier eingesehen werden, dass die Gesellschaft insgesamt neben den Waldbesitzern und Jägern die Lebensansprüche der Wildtiere in einem ausreichenden und nicht nur minimalen Umfang zu respektieren hat. Dazu sind Kompromisse von allen Beteiligten nötig: Beispiele seien der Verzicht auf die störende Nutzung der Wälder durch Erholungssuchende zur Nachtzeit oder auf das überbordende Laufen lassen von Hunden im Wald.
Wenn aber die Kulturlandschaft so ist wie sie nun ist, dann sind die Regulierungsmechanismen zwischen Pflanzenfressern auf der einen Seite und dem Raubwild und Jägern auf der anderen Seite so gestört, dass auch Verluste in der Vielfalt der Wälder entstehen können – die Biodiversität leidet. Eine besondere Rolle spielt hierbei ein Zuviel an Rehwild, welches selektiv in die Verjüngung eines Waldes eingreifen kann und das Aufkommen von Baumarten wie zum Beispiel der Eiche schlicht mit seinem Äser unterdrückt. Die Betrachtung geht also über die wirtschaftliche Dimension hinaus und hat auch eine ökologische Relevanz. Eine Entmischung der Wälder ist dringend zu vermeiden. Für das Rotwild ergibt sich die Notwendigkeit, eine wechselnde und ausreichende Raumnutzung sicherzustellen. Rotwild gehört zu den wandernden Wildarten, die die Deckungsmöglichkeit in dem einen Raum mit den Äsungsangeboten anderer Räume verbinden müssen. Beispielhaft sind die dem Rotwild durch Nutzung und Bebauung entzogenen Auengebiete, in das es gewöhnlich zur Winterszeit zu ziehen pflegte und dort auch überleben konnte, ohne forstwirtschaftliche Schäden anzurichten.

Problematisch ist die Sichtweise mancher Waldbesitzer und Jäger, eine bestimmte Wilddichte würde Schäden in jedem Fall vermeiden. Jedoch können tragbare Wilddichten immer nur am Lebensraumpotential ausgerichtet werden. Bei äsungsarmen Fichtenwäldern auf großer Fläche und vielleicht noch klimatisch kalten und dunklen, die Vielfalt der Bodenpflanzen eindämmenden Nordlagen können auch wenige Tiere große Schäden an der Verjüngung anderer Pflanzenarten ausrichten. Die Biokapazität ist also sehr verschieden und vom Jäger bei der Jagdausübung zu beachten.
Interessant ist die Feststellung, dass die Jagd zwar der Regulierung der Wildbestände dienen soll, sie selbst aber auch Wildschäden erhöhen kann. Werden an Feld-Wald-Grenzen Daueransitze durchgeführt, wird ein Nutzen der Feldflur als Äsungsraum sehr erschwert. Folglich vermehren sich Verbiss und Schälen im Wald. Auch überhöhter Jagddruck im Wald selbst schränkt die Lebensräume des Wildes ein und belastet die Einstandsgebiete.
In ähnlich negativer Weise wirkt sich das ständige Verbreiten menschlicher Witterung durch die Waldbesucher aus. Wildtiere müssen dann sehr viel mehr Zeit für die eigene Sicherung aufbringen, Zeit, die einer raumverteilten Äsungsaufnahme fehlt.
Im Wald-Wild-Konflikt wird auch ständig über die Frage der Fütterung gestritten. Ist z.B. der Anbau früchtetragender Bäume wie Wildobst und Kastanien entlang von Wegen oder am Rand von Wildwiesen noch allgemein akzeptiert, wird die Winterfütterung in Frage gestellt. Das diese aber – richtig betrieben – Wildschäden gerade in Hochlagen vermeidet, muss als nachgewiesen gelten.
Schließlich sollte man in der Diskussion auch eine geschichtliche Bewertung vornehmen. Während in der Nachkriegszeit Aufforstungen im Mittelpunkt standen, die diskussionslos von technischem Pflanzenschutz wie Zäunen, Drahthosen, chemischen Vergällungsmitteln oder Rindenhobeln begleitet waren, stellt sich die heutige Forstwirtschaft auf den Standpunkt, dass durch natürliche Verjüngung und Anreicherung eine naturnahe Bewirtschaftung ohne Schutz vor Wildschäden möglich sein muss. Das ökologische Jagdgesetz NRW fordert daher im § 1, „den Wildbestand so zu bewirtschaften, dass das Ziel, artenreiche, sich verjüngende Wälder ermöglicht wird“. Folgerichtig werden Verbissentwicklungen in einem Monitoring je Revier festgehalten. Waldbesitzer und Jäger sollten darüber hinaus durch gemeinschaftlich errichtete Kleinabzäunungen (Weisergatter) Erfahrungen über die Verjüngung ohne den Einfluss des Äsers sammeln.

Fazit dürfte sein: gelingt es, eine naturnahe oder naturgemäße Forstwirtschaft flächendeckend zu installieren, profitieren Wald und Wild. Den Weg dorthin muss ein gemeinsames Engagement von Waldbesitzern, Jägern und Gesellschaft in Sachen Wildschadensvermeidung sichern. Auf Seiten der Jagd sind neue Wege zu beschreiten wie Schwerpunktjagd dort, wo vermehrt verjüngt wird, Bewegungsjagden immer dann, wenn mit wenig zeitlicher Störung ein Optimum an Strecke möglich wird und Intervalljagd als Zugeständnis an das Wild, größere Ruhephasen zu nutzen.
Die naturnahe Forstwirtschaft hat in Alfred Möller schon in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts einen heftigen Verfechter gefunden, der biologische Gesetzmäßigkeiten in seinen Dauerwaldgedanken einbrachte und einen weiteren Verfechter in Hermann Krutzsch fand. Beide sollen in Zitaten zum Wald-Wild-Konflikt und den Grundlagen der naturgemäßen Forstwirtschaft gehört werden. Obwohl die Dauerwaldbewegung vor 100 Jahren ihren Ausgang nahm, sind bis heute noch andere, schlagweise Verfahren bis hin zu größeren Kahlschlägen üblich, die ihre Ursache in kleinbetrieblichen Strukturen oder zeitnahen Gewinnen haben. Häufig sind derartige Eingriffe nach Stürmen unvermeidlich. Auch ist es keineswegs das Ziel des Dauerwaldes oder einer naturgemäßen Waldwirtschaft, Prozessschutz zu installieren. Im Gegenteil geht gerade die Dauerwaldwirtschaft von permanenten Baumentnahmen – entweder einzeln oder in Gruppen – aus. Kahlschläge sind allerdings untersagt. Dauerwald garantiert in idealer Form die Vielfalt natürlicher Wirkungsmechanismen mit hoher nachhaltiger Nutzung von Holz und den Erhalt der übrigen Wohlfahrtswirkungen des Waldes. Diese Chance zur Nachhaltigkeit ist eigentlich ohne Alternative. Ihre Implementierung ist allerdings anders als von Krutzsch erwartet nicht in 50 Jahren, sondern eher in 100 Jahren oder darüber hinaus möglich.
Die Jägerseite soll Friedrich Karl von Eggeling vertreten, der in unserem Jahrhundert einen eigenen Forst bewirtschaftet und gleichzeitig ein großes Herz für Wild und Wald zeigt. Die Zitate sind bewusst in eine solche Reihe gesetzt worden, dass sie einem Dialog nahe kommen.

Die gezeigten Bilder sind Dokumente der Schönheit und Realität des Wald- und Wild-Wesens, gleichzeitig spiegeln sie das Gesagte wider.
Als weiterer fachlicher Einstieg wird eine Veröffentlichung der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung des Landes NRW empfohlen. Dr. Michael Petrak hat 2012 darin die Verhütung von Wildschäden im Walde als Aufgabe für Waldbesitzer, Forstleute und Jäger beschrieben ( ISSN 1864 9394 ).

Möller 1920: Freilich musste der Wildbestand in zulässigen Grenzen gehalten werden, der Jäger und Forstmann in der Person des Herrn Besitzers mussten den unvermeidlichen Kampf mit einander zu einem Ausgleich bringen; es galt vor allem, die den ganzen Tag herumziehenden Rehe nicht zu zahlreich werden zu lassen.

von Eggeling 1978: Die Zeit des Ehrgeizes, der angeblich Klügere gewesen zu sein, ist vorbei. Echte, richtige, lebendige Jagd hat so selten mit Klugheit zu tun, mit Zufall vielleicht, mit Glück zur rechten Stunde. Ich werde es darauf ankommen lassen, ich pürsche lieber mit offenem Auge und offener Seele – kommt der Bock, so kommt er, kommt er nicht, so lässt er´s eben. Ich jage nicht des Bockes wegen, dieses Bockes wegen. Das Glück soll in den Schoß fallen, unverhofft, unverlangt, als Geschenk dankbar und mit fröhlichem Herzen empfangen. Und überhaupt: Noch immer fröhlich, mit weit offenen Augen jagen zu dürfen, welches Glück! Es zu ertrotzen, unausgefüllt und schließlich sogar unbefriedigt, welch eine Sünde wider die Zeit, wider das Leben, dieses köstliche, kurze, uns nur geborgte Geschenk.

Möller 1922: Fortgeschrittene Beobachtung des Waldwesens führt aber den praktischen Forstmann zu immer häufigeren pflegenden Eingriffen, schließlich zu jährlichem Durchgehen des Waldes mit der Axt, und das Maß des Eingriffes lässt er sich nicht vorschreiben durch eine Tabelle, sondern durch das Bedürfnis des Waldes selbst. Was er an Holz entnahm, das wurde seine Ernte, nicht Vor- oder Zwischen-, sondern eigentliche Haupt-, freilich niemals Endnutzung, und es ergab sich, dass solche für unbegrenzte Zeit möglich wurde, ohne dass jemals eine Endnutzung auftrat .Der Wald wurde ein lebendiges Wesen ewiger Dauer und seine Bewirtschaftung eine Dauerwaldwirtschaft. Waldwirtschaft, wenn sie unseren Zwecken am besten dienen soll, kann nur Dauerwaldwirtschaft sein, eine andere wirklich rationelle Wirtschaft gibt es gar nicht.

Möller 1922: Es gewinnt dadurch unsere Auffassung des Waldbegriffs an Klarheit und Schärfe; wir erkennen in ihm ein tausendfach zusammengesetztes Ganzes, an welchem jedes Glied seine bestimmte Stelle einnimmt.

Möller 1922: Dauerwaldwirtschaft fordert den gemischten Wald, dessen Notwendigkeit Gayer so beredt dargelegt hat. Es gibt (vielleicht abgesehen von praktisch ganz bedeutungslosen Ausnahmefällen) keinen Waldboden in Deutschland, der nur eine Holzart zu tragen vermöchte und es gibt keine Forstwirtschaft (wieder abgesehen von fast selbstverständlichen Ausnahmen, wie Eichenschälwald, Weidenheger und, bedingt, Erlenbruch), welche ihre Ziele nachhaltig mit dem reinen Bestande erreichen könnte.

Krutzsch 1952: Zur waldfeindlichen Forstnebennutzung kann die Jagd werden. Ja sie ist es heute leider fast überall, weil die vorhandenen Bestände an Nutzwild in gar keinem Verhältnis zur vorhandenen oder auch nur möglichen natürlichen Ernährungsgrundlage des Wildes in unseren floristisch völlig verarmten Kunstwäldern stehen. Eine durchgreifende Regelung ist hier dringend geboten.

von Eggeling 2013: Seit siebzehn Jahren wirtschafte ich im eigenen Walde und bin meiner Wirtschaft dem Landesganzen verpflichtet, der Ökonomie ebenso wie der Ökologie – und ich tue mich blutig hart, beides in Einklang zu halten. Das Rotwild schält meine Fichten, die Rehe verbeißen mit dem Damwild um die Wette die Laubhölzer, die Zäunung kostet Geld, das der Wald nicht einbringt. Und der Wald schreit nach Wandlung, fort von der Eintönigkeit der Kiefer und Fichte, hin zu schöner Mischung mit Buche und Eiche, die dann auch standfest ist und sicherer gegen allerlei Insekten. Wie schrecklich nahe liegt es dann, dass Jagd zur Schädlingsbekämpfung verkommt, wie es hier und da schon üble Sitte ist.

Möller 1922: Ein schier unbegreifliches Missverständnis bedeutet die Annahme, im Dauerwalde brauche nicht kultiviert zu werden, die natürliche Verjüngung allein sei in ihm zulässig. Da Mischwald vom Dauerwald gefordert wird, so ist es selbstverständlich, dass man die Mischhölzer anbauen muss, wo sie nicht mehr vorhanden sind, so wie es selbstverständlich ist, dass der Dauerwaldbewirtschafter überkommene Kahlschlagflächen und Blößen aufzuforsten hat um auf ihnen baldmöglichst ein Waldwesen zu schaffen.
Ist einmal das gesunde Waldwesen in erwünschter Mannigfaltigkeit seiner Arten vorhanden, so ist natürliche Verjüngung nichts weiter als eine Lebensäußerung des Waldes, und künstliche Kultur kommt gar nicht mehr in Frage.

Krutzsch 1952: Es ist leider noch viel zu wenig bekannt, welche Schäden sowohl der Landwirtschaft als auch der Waldwirtschaft alljährlich durch zu hohe Nutzwildbestände zugefügt werden und wie notwendig es im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse ist, die Wildbestände soweit herabzumindern, wie es nicht nur die Erhaltung des vorhandenen Waldes, sondern vor allem die Umwandlung unserer floristisch und faunistisch verarmten Kunstwälder in artenreiche naturgemäße Wirtschaftswälder erfordert.

von Eggeling 2013: Und doch: Es ist ein hauchdünner Grat, der Jagen von Aasjägerei trennt, und manchmal erschrecke ich vor mir selber, wenn ich den Schadbock schoss, der mir die eben gepflanzten Lärchen zerschlug, und war doch ein Bock, der gern noch zwei, drei Jahre hätte leben sollen. Und schon gar nicht bin ich glücklich über die beiden Rotspießer mit ihren hohen Spießen, die in der Spitze schon eine Verdickung zur Krone zeigten. Aber soll ich zuwarten, dass mir das Rotwild die Fichtendickungen zu Tode schält und wahrscheinlich vergebens hoffen, dass ein geringerer Abschusshirsch mir vor die Büchse kommt? Wo soll ich mir die Grenzen setzen?

Krutzsch 1952: Solange Schälschäden des Rot-,Dam- und Muffelwildes in nennenswertem Umfang auftreten, und solange sich die jeweils standortsgemäße Holzartengemeinschaft wegen des Verbißschadens ohne Zaunschutz weder künstlich noch natürlich verjüngen lässt, ist an einen vollen Erfolg beim Aufbau des naturgemäßen Wirtschaftswaldes nicht zu denken. Wir müssen uns darüber vollkommen im Klaren sein, dass die Hege von Wildbeständen, die die Erreichung des heute allgemein anerkannten forstpolitischen Zieles nachhaltig höchster Massen- und Wertleistung verzögern oder beeinträchtigen, einen bewussten – meist sehr bedeutenden – Verzicht auf alle möglichen Massen- und Wertleistungen, also eine Einengung unserer Rohstoffbasis bedeutet.

von Eggeling 2013: Ich habe lernen müssen, dass Jagen zur Pflicht werden kann, immer dann, wenn ohne Jagd die Mitwelt von Mensch und Tier leiden müsste oder das Wild sich seine Mitwelt zerstört. Die Tragik und der Missmut, der hier das Jagen mitunter begleitet, liegt darin, dass es der Mensch war, der diese Situation herbeigeführt hat, die zu einem erschreckenden Circulus vitiosus wurde, einem Wettlauf zwischen dem Versuch der Besserung und den elementaren Ansprüchen des Wildes.

Möller 1922: Von allen Vorlesungen, welche die Forstakademie mir bot, machten den nachhaltigsten Eindruck die formvollendeten, glänzenden Vorträge Brefelds über allgemeine sowohl als systematische Botanik. Da ich diese eifrigst zu Hause nacharbeitete, empfand ich gar bald das Bedürfnis, jenes Werk, unter dessen gewaltigem Einfluss die gesamte Naturwissenschaft jener Tage sich befand, Darwins „Entstehung der Arten“ gründlich zu studieren. Das berühmte 3. Kapitel dieses Werkes trägt die Überschrift. „Struggle for existence“, was wir nach allgemeinem Brauche mit „Kampf ums Dasein“ treffend übersetzen. Ist der Inhalt dieses Kapitel auch wohl Gemeingut der Naturforscher geworden, so leider nicht aller Forstleute, obwohl gerade diese viel daraus hätten lernen können.

Krutzsch 1952: Es taucht die Frage auf, wie hoch die Bestände an Nutzwild zahlenmäßig sein dürfen, damit unsere waldwirtschaftlichen Ziele nicht in Frage gestellt werden. Eine allgemein gültige Antwort hierauf gibt es nicht. Das hängt im Wesentlichen davon ab, wieweit ein Waldgebiet durch die menschliche „Kultur“ floristisch verarmt ist, wieweit seine Bestockung von der natürlichen abweicht, ob die Standortsverhältnisse günstig oder ungünstig sind, ob das Wild auf den Feldern in der Nachbarschaft einen Ausgleich für die fehlende Äsung innerhalb des Waldes findet oder nicht, kurz wie die Ernährungsmöglichkeiten für jede einzelne Wildart beschaffen sind. Aber auch bei allerbesten Äsungsverhältnissen dürfen m.E. im Wirtschaftswalde je qkm nicht mehr als höchstens 2 bis 3 Stück Rotwild oder 5 bis 8 Stück Rehwild geduldet werden.

von Eggeling 2013: Jagd ist auch Schadensbegrenzung! Nur sollte sich der Jäger ganz klar darüber sein, dass die Begrenzung des Schadens dann enden muss, wenn die Lebensgrundlagen für Mensch und Tier im Walde sich so gewandelt haben, wie man es wünscht, dass also Schadensbegrenzung nach der Anzahl des Wildes wie nach der Zahl der Jahre zu berechnen ist und nicht zu einem Prozess verkommt, der schlussendlich doch nur den Menschen als Maß aller Dinge setzt.

Krutzsch 1952: Man kann der berechtigten Hoffnung Ausdruck geben, dass der Aufbau eines naturgemäßen Wirtschaftswaldes in 3 bis 4 Jahrzehnten bei Beschränkung der Nutzwildbestände auf das notwendige Maß wenigstens soweit eingeleitet ist, dass seine Fortführung gesichert erscheint. Dann werden wir aber auch – wenigstens teilweise – die Äsungsverhältnisse für das Wild durch Wiederverbreitung der natürlichen Äsungspflanzen – vor allem Aspen, Weidenarten und sonstige Sträucher und Kräuter – so weit gebessert haben, dass auch in den Wirtschaftswäldern wieder wirklich wertvolle Wildbestände herangehegt werden können, soweit durch sie die Biozönose des Waldes nicht wiederum zerstört wird.

von Eggeling 2013: Mein Leben ist reich geworden mit der Jagd in allen ihren Facetten. Reich geworden mit der Jagd, für die Jagd, mit dem Wilde und für das Wild und hat sich entwickelt vom kindlichen Ungestüm hin zum sehr bewusst beglückenden Tun im großen Geschenk von Freiheit bis zum Jagen als Pflicht und mit allen diesen endlich zum Wunsch, vieles und mehr verstehen zu wollen um Schöpfung und Geschöpf in unerfüllbarer Sehnsucht nach eine heilen Welt voller Wunder.
Literatur:
- Alfred Möller Der Dauerwaldgedanke Berlin 1922
- Alfred Möller Kiefern-Dauerwaldwirtschaft Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1920
- Hermann Krutzsch Waldaufbau Berlin 1952
- Friedrich Karl von Eggeling Horscha Wien 2013
- Friedrich Karl von Eggeling Wie es Diana gefällt Hamburg, Berlin 1978
Text: Dr. Norbert Möhlenbruch Bilder: Dr. Hanns Noppeney

